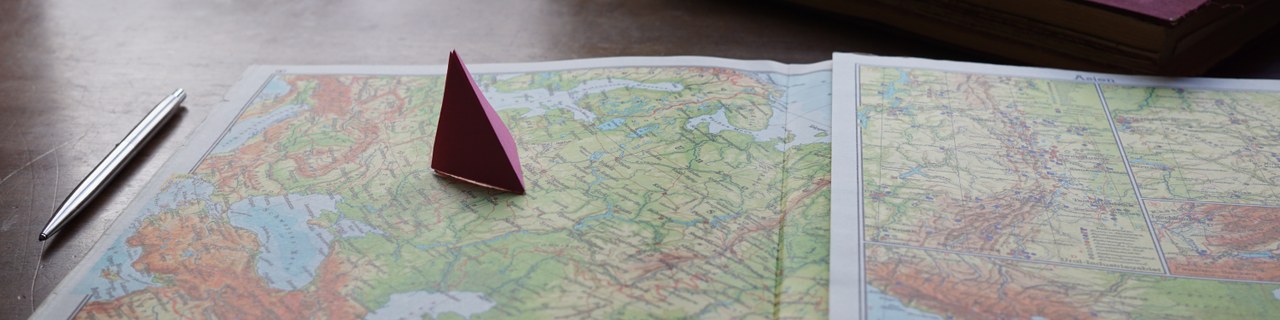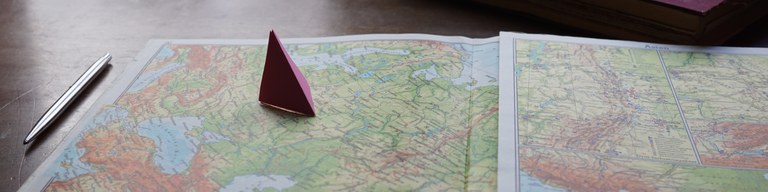
Ziele
Auf dieser Seite finden Sie in alphabetischer Reihenfolge alle Entwicklungsziele für Studium und Lehre, die in der STEP-Datenbank hinterlegt sind. Sollte ein Ziel für Sie von Interesse sein, klicken Sie es einfach an, um mehr zum Ziel und den damit verknüpften Maßnahmenideen zu erfahren.
| Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Angebotsorientierte Lehrplanung im Studiengang | Die Lehrplanung eines Studiengangs am vorhandenen Lehrangebot - Lehrpersonal &-deputat zu orientieren, hilft dabei insbesondere im Rahmen einer Neuentwicklung oder umfangreichen Umstrukturierung eines Studiengangs das Curriculum und dessen daraus entstehende Lehrangebot anhand vorhandener Ressourcen zu planen. So können etwa ressourcenintensive Module oder Lehrveranstaltungen im Vorfeld identifiziert und ggf. umgeplant werden. |
| Anteil internationaler Studierender erhöhen | Ziel ist eine Erhöhung internationaler Studierenden im Studiengang, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben. Die Einschreibung kann entweder temporär (Austauschstudierende), oder zum Erwerb eines Abschlusses erfolgen. Eine zunehmend internationale Studierendenschaft verbessert dabei die Internationalisierung von Studium und Lehre sowie die Diversität der Hochschule. |
| Arbeitsbelastung im Studium erhöhen | Die Arbeitsbelastung bemisst sich in Arbeitsstunden, die Studierende aufwenden müssen, um das Studium zu absolvieren und die Studienziele zu erreichen. Sind die tatsächlich aufgebrachten Arbeitsstunden wesentlich niedriger als in der Prüfungsordnung und dem Modulhandbuch festgeschrieben, ist eine Nachsteuerung äußerst sinnvoll, um Unterforderungen und Unzufriedenheit im Studium entgegenzuwirken. |
| Arbeitsbelastung im Studium reduzieren | Die Arbeitsbelastung bemisst sich in Arbeitsstunden, die Studierende aufwenden müssen, um das Studium zu absolvieren und die Studienziele zu erreichen. Sind die tatsächlich aufgebrachten Arbeitsstunden wesentlich höher als in der Prüfungsordnung und dem Modulhandbuch festgeschrieben, ist eine Reduzierung der Arbeitsbelastung sinnvoll, um u.a. die Studierbarkeit des Studiengangs zu verbessern. |
| Arbeitsformen der Lehrveranstaltung umgestalten | Die Arbeitsformen einer Lehrveranstaltung sollten sich grundsätzlich nach den im Modul zu erreichenden Qualifikationszielen und zu erwerbenden Kompetenzen richten und daran ausgerichtet werden. Sollte eine Passung zwischen beiden Bereichen nicht vorhanden sein, aber die Qualifikationsziele und zu erwerbenden Kompetenzen weiterhin bestehen bleiben sollen, sollte über eine Veränderung der Arbeitsformen und /oder der Prüfungsformen nachgedacht werden. |
| Attraktivität der Masterangebote steigern | In Deutschland gibt es laut dem statistischen Bundesamt rund 10.000 Masterstudiengänge, so dass diese Vielzahl an konsekutiven Masterstudiengängen von BachelorabsolventInnen schwer zu überschauen ist. Aufgrund dessen ist es um so wichtiger, die eigenen Masterstudiengänge möglichst attraktiv für BachelorabsolventInnen zu gestalten. Nur so kann die Studierendennachfrage gesichert werden. |
| Auslandsmobilität erhöhen | Durch eine Ausweitung von Aufenthalten inländischer Studierender im Ausland sowie ausländischer Studierender im Inland, soll der grenzüberschreitende Austausch zwischen Studierenden gefördert werden (z.B. mit Auslandssemestern, Doppelabschlüssen oder Praktika im Ausland). Dadurch können wichtige soziale, persönliche und ggf. auch fachliche Kompetenzen der Studierenden gefördert sowie die grenzüberschreitende Kommunikation verbessert werden. |
| Auslastung der Lehreinheit erhöhen | Die Auslastung einer Lehreinheit zeigt an wie viel Prozent des verfügbaren Lehrangebots (Personaldeputat) durch die eingeschriebenen Studierenden nachgefragt werden. Ist die Lehrnachfrage (Lehraufwand der Lehreinheit für die Studierenden ihrer eigenen Studiengänge) geringer als das eigene Lehrangebot, so ist die Lehreinheit unterausgelastet. Hier sollte eine Erhöhung der Auslastung angestrebt werden. |
| Bachelor-Master-Übergang erleichtern | Einen guten Übergang vom Bachelor- in das Masterstudium zu ermöglichen, ist eine wichtige Grundbedingung für die Qualität des Masterprogramms. Denn nur wenn die Studierenden fachlich ähnliche Niveaus vorweisen oder dies zu Beginn ihres Masterstudiums nachholend erreichen können, kann das erwünschte fachlich hohe Niveau eines Masterstudienprogramms erreicht werden. |
| Basis-/ Grundlagenwissen stärken | Das Grundlagenwissen, welches Studierenden am Anfang ihres Studiums vermittelt wird, bildet die Basis für spätere Lehrveranstaltungen. Wird deutlich, dass gewisse Grundlagen in Folgeseminaren nicht verinnerlich wurden kann es hilfreich sein den Umfang und die Dauer von Veranstaltungen die Grundlagenwissen vermitteln auszubauen. |
| Berufsperspektiven stärken | Berufsperspektiven zu stärken, bedeutet zu wissen, welche Studieninhalte Absolventen bei der beruflichen Tätigkeit helfen im Beruf zu bestehen und dieses Wissen den Studierenden deutlich zu machen. Berufsperspektiven sind ein zentraler Bestandteil des Studiums |
| Betreuung in der Lehre verbessern | Eine Verbesserung der Betreuung in der Lehre kann dazu führen, dass Studierende eher in der Lage sind sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten und eine Auseinandersetzung mit der Thematik auf individueller Ebene möglich wird. Ein gutes Betreuungsverhältnis kann Studienabbrüche reduzieren und die allgemeine Stimmung am Fachbereich deutlich verbessern. |
| Career-Aktivitäten ausbauen | Career-Aktivitäten liegen traditionell weniger im Verantwortungsbereich der Universität. Studierende sind jedoch häufig unsicher, was sie mit dem Erlernten später beruflich machen können oder welche Kompetenzen sie stärken sollen. |
| Digitale Barrieren reduzieren – Barrieren durch Digitalisierung abbauen | Digitale Barrieren in der Lehre und Studiengangorganisation abzubauen, kann deutlich zur inklusiven Öffnung von Studiengängen beitragen. Es ermöglicht Studierenden mit Sinnesbeeinträchtigungen und bestimmten motorischen Behinderungen eine Teilhabe am Studium mit mehr Chancengleichheit. Gut zugänglich gemachte digitale Dokumente, Programme und Abläufe können darüber hinaus allen zugutekommen. |
| Einschreibungen erhöhen/ mehr Studierende gewinnen | Mehr Studierende im Studiengang verbessern sowohl die Attraktivität und den Ruf des Studiengangs als auch die finanzielle Situation des Studiengangs und damit auch der Philipps-Universität Marburg. Zusätzlicher Nebeneffekt ist unseren Erfahrungen nach dabei auch, dass bis zu einer gewissen Kohortengröße etwa auch das Studienklima verbessert und damit letztlich Zufriedenheit unter den Studierenden erhöht wird. |
| Englischsprachige Lehre im Studiengang etablieren | Ausweitung von Lehrveranstaltungen (ggf. von ganzen Modulen), die in einem regelmäßigen Turnus in englischer Sprache angeboten werden. Dabei soll nicht nur die Umgangs-, sondern auch die englische Fachsprache vermittelt werden, wodurch sich die internationalen und interkulturellen Kompetenzen der Studierenden deutlich verbessern lassen. |
| Fachbezogene Fremdsprachenkenntnisse stärken | Ausweitung von Lehrveranstaltungen und/oder Sprachkursen, die in einem regelmäßigen Turnus entweder in einer Fremdsprache oder zur Erlernung dieser Fremdsprache angeboten werden. Dabei soll nicht nur die Umgangs-, sondern insbesondere die fremde Fachsprache vermittelt werden, wodurch sich die internationalen Kompetenzen der Studierenden deutlich verbessern lassen. |
| Fachliche Kompetenzen stärken | Die fachliche Kompetenz bildet sich über die Zeit die Studierende am Fachbereich Veranstaltungen besuchen. Sie kann als fachspezifischer Komplex verstanden werden der Studierenden ermöglicht sich über fachliche Themen und Theorien auszutauschen und Wissen oder Diskurse mit einem fachspezifischen Blick einzuordnen. |
| Fachwechsel reduzieren | Ein Fachwechsel ist ein Wechsel eines Studierenden aus Studiengang a in Studiengang b. Dieser Wechsel kann innerhalb der Universität aber auch an eine andere Universität stattfinden. Fachwechsel zu reduzieren intendiert diese Wechsel zu unterbinden und stattdessen mehr Studierenden einen erfolgreichen Studienabschluss zu ermöglichen. |
| Fehlende Vorkenntnisse nachholen / ausgleichen | Bestimmte Kenntnisse sind notwendig um einen Studiengang studieren zu können. Ideallerweise haben Erstsemeseter sich diese bereits in der Schule angeeignet. Jedoch haben nicht alle Abiturienten den gleichen Lernstand, dies bedeutet sie müssen bestimmte Kenntnisse nachholen, um im Studium bestehen zu können. |
| Flexibilisierung im Studium erhöhen | Ein flexibles Studium wird angesichts der zunehmenden Heterogenität der Studierenden immer wichtiger. Viele Studierende haben persönliche Verpflichtungen und benötigen Lösungen, um diese mit dem Studium zu vereinbaren. Andere brauchen gezielte Unterstützung zum Studienstart, damit sie Wissenslücken schließen und besser ankommen können. Flexibilisierungsmaßnahmen helfen Studierenden, ihr Studium bestmöglich an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. |
| Forschungsbezug stärken | Aktuelle Forschungsthemen sind für viele Studierende ein Grund sich für ein bestimmtes Fach einzuschreiben oder sich später für einen bestimmten Schwerpunkt zu spezialisieren. Das Stärken des Bezuges zu aktueller Forschung oder Forschungsthemen im Allgemeinen kann Veranstaltungen für die Studierenden nicht nur interessanter gestalten, sondern hilft ihnen auch dabei ihren eigenen fachlichen Schwerpunkt zu entwickeln. |
| Gute Studienbedingungen schaffen | Gute Studienbedingungen haben einen großen Anteil am Studienerfolg der Studierenden. Sie geben den Rahmen für die Anstrengungen der Studierenden das Studium zu schaffen. Gute Studienbedingungen begünstigen den Studienerfolg. Widrige Studienbedingungen dagegen führen zu Unzufriedenheit und begünstigen Studienabbruch. |
| Gutes Studienklima schaffen | Ein gute Atmosphäre in der Kohorte eines Studiengangs oder am Fachbereich ist eine wichtige Voraussetzung für ein gelungenes Studium. Sie kann sich nicht nur positiv auf die Zufriedenheit der Studierenden auswirken, sondern auch den Studienerfolg und den Verbleib im Studiengang befördern. |
| Informationsangebot & -aufbereitung verbessern | Das Informationsangebot und dessen Aufbereitung zu verbessern, dient gleich mehreren Zwecken. Zum einen wird dadurch die Außendarstellung des Studiengangs verbessert was den Studiengang insbesondere für Studieninteressierte attraktiver, da verständlicher und sichtbarer macht. Zum anderen verbessert ein gutes und verständlich aufbereitetetes Informationsangebot das Wissen der Studierenden über Ihr Studium und ermöglicht somit ein zielgerichteteres und selbstbestimmtes Studium. |
| Informationsangebot zum Studieneinstieg verbessern | Das Informationsangebot zu Beginn des Studiums ist zentraler Bestandteil der ersten zwei Wochen. Ziel ist es den Studierenden zu Beginn möglichst die wichtigsten Informtionen erreichbar zu machen ohne diese zu überfordern. |
| Kapazitäts-/Nachfrageorientierte Lehrplanung im Studiengang | Das Lehrangebot eines Studiengangs kapazitätsorientiert zu planen, hilft dabei ressourcen- und nachfragegerecht Lehre anzubieten und sich "nicht zu übernehmen" oder zu verplanen und so unnötige zusätzliche Lehraufträge zu vergeben. Zudem kann eine nachfrageorientierte Lehrplanung ggf. bisher eher wenig genutzte Lehrpotentiale identifizieren und dahingehend einzusetzen, dass man diese an anderen Stellen die etwa besonders aufwendig sind oder Bedarf haben einsetzt. |
| Konsekutivität des Studienangebots sichern | Die Konsekutivität des Studiengangsangebots zu sichern, bedeutet, dass es mindestens einen Masterstudiengang an der UMR geben sollte, der auf dem vorhandenen Bachelorstudiengang der UMR fachlich aufbaut. Dadurch ist für einen Studierenden bereits bei der Aufnahme des Bachelors die fachliche Anschlussfähigkeit innerhalb der UMR sichergestellt. |
| Lehrveranstaltung didaktisch umgestalten | Eine Lehrveranstaltung didaktisch umzugestalten, kann helfen die Studierenden besser zu erreichen und das Interesse für die Inhalte zu stärken. Die Form wie Inhalte transportiert werden, kann für den Lernerfolg entscheidend sein. Interaktive Formen wie Diskussionen und Gruppenarbeiten können den Studierenden beispielsweise ein Thema durch verschiedene Blickwinkel vermitteln. |
| Lehrveranstaltung digitalisieren | Um Veranstaltungen besser zugänglich zu machen um beispielsweise Überschneidungen mit anderen Modulen zu umgehen oder Grundlagen zum Lernen für alle Studierende verfügbar zu machen, kann es sinnvoll sein, Lehrveranstaltungen zu digitalisieren. In welcher Form die Lehrveranstaltung digitalisiert werden soll ist abhängig von der Art der Lehrveranstaltung und wie diese genutzt werden soll. |
| Lehrveranstaltung inhaltlich umgestalten | Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass es nötig wird bestehende Lehrveranstaltungen inhaltlich umzugestalten. Verschieben sich beispielsweise die Schwerpunkte innerhalb eines Moduls, oder sogar eines ganzen Studienganges kann es sinnvoll sein, die Lehrinhalte auf ihre Passgenauigkeit hin zu überprüfen und anzupassen. |
| Leistungsdruck im Studium reduzieren | Die Wahrnehmung eines starken Leistungsdruckes kann Studierende einschränken, indem sie glauben, den Aufgaben nicht mehr gewachsen zu sein oder die Aufgaben nur unter höchster Anstrengung bearbeiten zu können. Die Reduzierung des Leistungsdruckes kann dazu führen, die Zufriedenheit der Studierenden zu erhöhen und die Studierbarkeit eines Moduls oder Studiengangs zu verbessern. |
| Methodenkompetenz stärken | Die am Fachbereich angewendeten Methoden helfen den Studierenden im jeweiligen Studiengang zu bestehen. Mit einer Stärkung dieser Kompetenzen können Studierende eher eigenverantwortlich Probleme lösen und in Forschungsprojekten bestehen. Je nach Fachbereich kann sich die Relevanz für Methodenkompetenz stark unterscheiden. |
| Modulanteile des eigenen Faches im Studiengang erhöhen | Die zur Verfügung stehenden Leistungspunkte werden zu einem größeren Anteil durch Module mit eigenen Fachinhalten in das Curriculum des Studiengangs eingespeist. Im Gegenzug dazu werden Module mit fachfremden oder überfachlichen Inhalten reduziert. Die Veränderung dieses Verhältnisses von eigenen Inhalten zu fremden Inhalten hat Konsequenzen für die Qualifikationsziele des gesamten Studiengangs. |
| Module besser aufeinander abstimmen | Die wechselseitige Abstimmung der Module eines Studiengangs ist ein zentraler Aspekt von dessen Studierbarkeit und fördert einen zielgerichteten und hindernisfreien Studienverlauf. Beziehen sich die Module eines Studiengangs aufeinander und ergänzen sich idealerweise, trägt dies zu einem kohärenten Gesamtbild des Lehrangebots und des Studiengangs als Ganzem bei. |
| Modulhandbuch ändern | Ein Modulhandbuch soll umfassende Informationen zu Modulen eines Studienganges bieten. Werden Module modifiziert, ist die Anpassung des Modulhandbuchs von essentieller Bedeutung, um aktuelle und gesicherte Informationen zu Modulen eines Studiengangs transparent zur Verfügung zu stellen. Dies trägt u.a. zur Studierbarkeit des Studiengangs bei und kann die Zufriedenheit bei Studierenden erhöhen. |
| Modulhandbuch realitätsnah gestalten | Ein Modulhandbuch umfasst alle wichtigen Informationen zu den Modulen eines Studiengangs. Ein wichtiges Ziel bei der Erstellung oder Überarbeitung des Modulhandbuchs ist die wirklichkeitsgetreue Gestaltung des Modulhandbuchs, damit Studierende zuverlässige Informationen über die Module ihrer Studiengänge erhalten. Dies trägt zur besseren Studierbarkeit der Studiengänge und zur Zufriedenheit der Studierenden bei. |
| Nebenfachanteil erhöhen | Die zur Verfügung stehenden Leistungspunkte werden zu einem größeren Anteil durch Module mit fachfremden Inhalten in das Curriculum des Studiengangs eingespeist. Im Gegenzug dazu werden Module mit eigene Fachinhalten reduziert. Die Veränderung dieses Verhältnisses von eigenen zu fremden Inhalten hat Konsequenzen für die Qualifikationsziele des gesamten Studiengangs. |
| Neuen internationalen Studiengang entwickeln | Entwicklung eines fremdsprachigen Studiengangs, eines Studiengangs mit obligatorischem Auslandsjahr, oder eines Joint Programme auf Basis von fachlichen und überfachlichen Qualifikationszielen, die die internationalen Studierenden bei Abschluss des Studiengangs erlangt haben sollen. Diese Qualifikationsziele werden in konkrete Kompetenzen übersetzt, die in Modulen (bzw. Modulbereichen) an die Studierenden vermittelt werden sollen. |
| Neuen Studiengang entwickeln | Entwicklung eines Studiengangkonzeptes und einer Prüfungsordnung auf Basis von fachlichen und überfachlichen Qualifikationszielen, die die Studierenden bei Abschluss des Studiengangs erlangt haben sollen. Diese Qualifikationsziele werden in konkrete Kompetenzen übersetzt, die in Modulen (bzw. Modulbereichen) an die Studierenden vermittelt werden sollen. |
| Passung der Lehrveranstaltungen zum Modul erhöhen | Eine möglichst genaue Passung der Lehrveranstaltungen eines Moduls ist zentral für das Erreichen der mit dem Modul beabsichtigten Qualifikationsziele sowie dessen Studierbarkeit. Sind die Lehrveranstaltungen eines Moduls mit den Modulzielen im Einklang und ergänzen sich idealerweise, trägt dies zu einem kohärenten Gesamtbild des Lehrangebots des Studiengangs bei und trägt zu einem reibungsfreien Studienverlauf bei. |
| Praxisbezüge stärken | Den Praxisbezug der Studieninhalte im Studium zu vermittlen, hilft St Praxisbezüge stärken, bedeutet die einzelne Studieninhalte auf die mögliche Verwendbarkeit im späteren Beruf auszurichten. |
| Prüfung des Moduls umgestalten | Modulprüfungen haben mehrere Funktionen. Sie markieren den Abschluss der Lerneinheiten eines Moduls und geben Aufschluss, ob dessen Qualifikationsziele erreicht wurden. Neben der formalen Bescheinigung der Modulziele geben sie den Studierenden Hinweise zur Weiterentwicklung und Verbesserung ihres eigenen Lernstandes. Wird eine Modulprüfung diesen Aufgaben nicht gerecht, bietet sich eine Umgestaltung an. |
| Prüfungsordnung ändern | Die Prüfungsordnung stellt den rechtlichen Rahmen für einen Studiengang dar, in dem u.a. der Aufbau des Studiengangs rechtsverbindlich verankert ist. Die Änderung der Prüfungsordnung kann ein wichtiges Instrument sein, um formelle sowie fachlich-inhaltliche Anpassungen am Studiengang vorzunehmen und den Studiengang dadurch weiterzuentwickeln und attraktiver zu gestalten. |
| Qualifikationsziele des Moduls realitätsnah formulieren | Qualifikationsziele sind zentraler Bestandteil eines Moduls und definieren dessen inhaltliche wie methodische Ausrichtung. Sie stellen quasi das Profil des Moduls dar und fassen zu erlernende Inhalte, Methoden und Kompetenzen zusammen. Ihre realistische Formulierung erleichtert die korrekte Einschätzung von Inhalten und deren Schwierigkeitsgrad durch die Studierenden. Dies trägt maßgeblich zur Studierbarkeit eines Moduls bei. |
| Qualitätssicherung in Studium und Lehre ausbauen | Sie haben bereits Kontakt mit dem QSS Team gehabt und auch schon ein zwei Erhebungen durchgeführt und Fragen sich wie es nun weitergehen kann. Eine Möglichkeit ist weitere Felder in ihrem Studiengang zu finden, welche sie noch nicht untersucht haben. Was haben Sie nach der letzten Evaluation verändert und haben die Anpassungen ihr Ziel erreicht? |
| Re-/Akkreditierung eines Studiengangs | Die (Re-)Akkreditierung eines Studiengangs zeichnet sich durch die Verleihung des Gütesiegels durch den Akkreditierungsrat aus. Soll ein neuer Studiengang entwickelt oder ein aktueller Studiengang weitergeführt werden, ist die (Re-)Akkreditierung unerlässlich, da sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Qualität von Studiengängen leistet und nicht zuletzt gesetzlich verankert ist. |
| Schlüsselkompetenzen/Future Skills stärken | Es werden neuen Module zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen entwickelt und in das Curriculum des Studiengangs eingeführt, oder bestehende Module stärker auf die Vermittlung der entsprechenden Kompetenzen ausgerichtet (z.B. durch veränderten Prüfungsformen). Klassische berufsbildende sozial- und Individualkompetenzen sind dabei heute ebenso wie fachübergreifende Methodenkompetenzen in der Gestaltung von Studiengängen besonders gefragt. |
| Schwierigkeitsgrad des Moduls erhöhen | Der Schwierigkeitsgrad eines Moduls hat mehrere Ebenen. Einerseits sind Komplexität und Menge der im Modul vermittelten Lerninhalte ein zentraler Faktor. Andererseits wirkt sich auch die Geschwindigkeit, mit der der Stoff von den Lernenden aufgenommen und verarbeitet werden muss auf den wahrgenommenen Schwierigkeitsgrad aus. Eine angemessene Verringerung des Schwierigkeitsgrades beugt einer Unterforderung der Studierenden vor und verbessert die Studierbarkeit des Moduls. |
| Schwierigkeitsgrad des Moduls verringern | Der Schwierigkeitsgrad eines Moduls hat mehrere Dimensionen. Einerseits sind Komplexität und Menge der im Modul vermittelten Lerninhalte ein zentraler Faktor. Andererseits wirkt sich auch die Geschwindigkeit, mit der der Stoff von den Lernenden aufgenommen und verarbeitet werden muss auf den wahrgenommenen Schwierigkeitsgrad aus. Eine angemessene Verringerung des Schwierigkeitsgrades beugt einer Überforderung der Studierenden vor und verbessert die Studierbarkeit des Moduls. |
| Soziale Integration der Studierenden ins Studium verbessern | Die soziale Integration der Studierenden umfasst die Eingebundenheit der Studierenden in das soziale Gefüge der Kommiliton*innen und Lehrenden der Universität. Die Verbesserung der sozialen Integration kann sich nicht nur positiv auf die Zufriedenheit der Studierenden auswirken, sondern auch auf ihren Studienerfolg und Studienverbleib. |
| Soziale Kompetenzen stärken | Kommunikations- und Interaktionssituationen besser bewältigen zu können, ermöglicht Studierenden nicht nur ihre persönlichen Bedürfnisse besser zu artikulieren, sondern auch, sich in Fachlichen Diskussionen besser einzubringen. Die Fähigkeit, in Diskussionen eigene fachliche Standpunkte vertreten zu können, stellt einen wichtigen Baustein des Studiums dar. |
| Studien(-fach)-beratung verbessern | Die Studien(-fach)-beratung ist gemäß § 14 Hessisches Hochschulgesetzt eine Aufgabe der Hochschulen. Sie zu verbessern, dient im Wesentlichen einer besseren Information der Studierenden und dass Herausforderungen und Probleme, die sich im Studium ergeben, schneller und besser gelöst werden. Dadurch wird die Studierbarkeit, der Studienerfolg der Studieingänge und damit letztlich auch die Zufriedenheit der Studierenden erhöht. |
| Studienabbrüche reduzieren | Studienabbrüche reduzieren intendiert die engültige Aufgabe des Studiums zu verhindern, in dem mehr Studierende zum erfolgreichen Abschluss oder wenigsten zum Studienfachwechsel geführt werden. Denn ein Studienabbruch hat nicht nur für die Person individuell negative Folgen, sondern erzeugt auch ökonomische Kosten für die Gesamtgesellschaft und finanzielle Nachteile für die Universität. |
| Studienabschlüsse erhöhen | Mehr Studierenden einen erfolgreichen Studienabschluss zu ermöglichen und damit die Studienabschlussquote zu erhöhen geht mit dem Ziel der Verringerung der Studienabbrüche einher und ist eines der zentralen Ziele der Hochschulpolitik. Mehr Studienabschlüsse zu generieren, bestenfalls innerhalb der Regelstudienzeit, stellt aus viellerlei Gründen ein bedeutsames Ziel dar. |
| Studienabschlüsse in Regelstudienzeit erhöhen | Die Anzahl der Studierenden die einen Studienabschluss in Regelstudienzeit erzielen zu erhöhen, ist ein in vielerlei Hinsicht wichtiges Ziel für qualitativ hochwertige Studiengänge. Zum einen ist ein möglichst regelhafter und planbarer Studienverlauf und -abschluss inzwischen ein wichtiges Studienziel der StudienanfängerInnen und wird zum anderen auch im Rahmen der Studierbarkeit der externen und internen Qualitätssicherung untersucht. |
| Studienangebot des Fachbereichs überarbeiten | Das Studienangebot eines Fachbereichs vollumfänglich oder auch nur teilweise zu überarbeiten intendiert i.d.R. eine attraktiveres Studienangebot durch umfangreiche Veränderungen im Angebot der fachbereichseigenen Studiengänge. Dies kann sowohl nur den grundständigen Studienbereich aber auch abschlussübergreifend alle Studiengänge betreffen und insbesondere strukturelle und/oder fachlich-inhaltliche Gründe haben. |
| Studieneinstieg erleichtern | Zum Studieneinstieg stehen Erstsemester vor einer großen Herausforderung isch nach der Schule an der Universität zurecht zu finden. Sie sind allein verantwortlich alle notwendigen Informationen zu beschaffen und ihr Studium zu planen. Nicht desto trotz ist es hilfreich ihnen die ertsen Schritte der Eigenvarantwortung zu erleichtern um einen guten Start ins Studium zu finden. |
| Studienleistung des Moduls umgestalten | Die Umgestaltung der Studienleistung(en) kann die Studiererfahrung des Moduls deutlich verbessern. Zentral sollte sein, dass die Veranstaltungen und ihre Lehr- und Lernmethoden auf das Erreichen der Qualifikationsziele abgestimmt sind. Insbesondere wenn dadurch eine engere didaktische und inhaltliche Ausrichtung auf die Qualifikationsziele erzielt wird, steigen Studierbarkeit und Lernerfolg im Modul. |
| Studienstruktur umfassend verändern | Die umfassende Veränderung der Studienstruktur im Sinne einer grundlegenden Änderungen des Studienaufbaus und ggf. sogar der Studieninhalte sind auf Studiengangsebene die größtmöglichen und tiefgreifensten Veränderungen. Sie sollten nur vorgenommen werden, wenn der Studiengang neu ausgerichtet werden soll oder massive Probleme in der Studierbarkeit oder dem Studienerfolg der Studierenden auftreten. |
| Studienstruktur vereinfachen | Die Studienstruktur zu vereinfachen kann dabei helfen die Verständlichkeit und die Studierbarkeit seitens der Studierenden zu erhöhen und damit letztlich einen höheren und/oder schnelleren Studienerfolg zu erreichen. Eine klare und einfache Studienstruktur ohne (über-)komplexe Wahlmöglichkeiten und Konsekutivbedingungen ist gerade beim Studieneinstieg in grundständigen Studiengängen hilfreich, um orientiert ins Studium zu starten. |
| Studienziele realitätsnah formulieren | Die Studienziele geben Aufschluss über die Qualifikationen, die Studierende im Rahmen ihres Studiums erwerben. Die realitätsnahe Formulierung der Studienziele stellt Transparenz hinsichtlich eines Studiengangs her und trägt insbesondere bei Studieninteressierten dazu bei, dass sie eine bewusste Studienentscheidung treffen können und nicht mit falschen Erwartungen ins Studium starten. |
| Studierbarkeit erhöhen | Die Studierbarkeit eines Studiengangs zu gewährleisten ist eine Grundbedingung für die Einführung und Akkreditierung eines Studiengangs. Dieses ist damit eines der zentralesten, aber zugleich auch umfangreichsten, Qualitätskriteriums sowie Weiterentwicklungsziel, welches in internen wie auch externen Qualitätssicherungsprozessen in den Blick genommen wird. Studierbarkeit meint dabei zunächst die Gewährleistung eines regulären Studienverlauf in Regelstudienzeit für (Vollzeit-) Studierende zu gewährleisten. (KMK, 2017, Studienakkreditierungsstaatsvertrag) Im Wesentlichen erzeugt eine gute Studierbarkeit aber auch eine hohe Zufriendenheit unter den Studierenden und ist somit zusätzlich zu den formalen Kriterien ein bedeutender Aspekt. |
| Studium nach Musterstudienplan ermöglichen | Der Musterstudienplan gibt vor, welche Veranstaltungen besuchtund welche Leistungen, in welchem Zeitraum erbracht werden müssen. Studieren nach Musterstudienplan hilft das Studium leichter zu strukturieren und sollte helfen das Studium in Regelstudienzeit abschliessen zu können. |
| Themenspektrum verbreitern | Das Themenspektrum eines Studiengangs zu verbreitern zielt darauf ab ihn thematisch zu öffnen und eine potentiellen Überspezialisierung entgegen zu wirken. Durch das breitere Themenspektrum könnte der Studiengang auch für eine größere Gruppe potentieller Studierenden interessant sein und damit potentiellen Nachfrageschwierigkeiten entgegenwirken. |
| Überschneidungsfreiheit im Studiengang gewährleisten | Überschneidungsfreiheit von Modulen und Lehrveranstaltungen systematisch zu gewährleiten ist eine wichtige Bedingung für einen möglichst studierbaren Studiengang für die Studierenden. Pflichtveranstaltungen dürfen sich zudem auch zeitlich gar nicht überschneiden und Wahlpflichtveranstaltungen sollten dies möglichst auch nur bergrenzt tun, um einen möglichst planbaren Studienverlauf und damit auch möglichst zeitnahen Studienabschluss zu gewährleisten. |
| Vereinbarkeit Studium und Familie/Beruf erhöhen | Durch entsprechende Hilfestellungen und Flexibilisierungen soll Studierenden, die neben ihrem Studium Kinder betreuen, Familienangehörige pflegen, oder berufliche Aufgaben erfüllen (müssen), ein möglichst reibungsloser Ablauf des Studiums ermöglicht werden. Dies dient nicht nur der uneingeschränkten Teilhabe an der Hochschulbildung, sondern kann insbesondere auch Abbruch- und Erfolgsquoten verbessern. |
| Wissenschaftliche Kompetenzen stärken | Wissenschaftliches Arbeiten ist eines der Fundamente von universitärer Forschungsarbeit. Je besser Studierende darin geschult sind, nach den wissenschaftlichen Prämissen ihres Fachbereiches vorzugehen, desto eher sind sie in der Lage eigene Forschungsprojekte zu entwickeln und den Weg von Wissenschaftler:innen zu beschreiten. |
| Workload des Moduls verändern | Der Workload eines Moduls ist der in Zeitstunden ausgedrückte erwartete studentische Arbeitsaufwand, der die Grundlage für die Zuordnung von ECTS-Punkte zu Modulen bzw. Lehrveranstaltungen darstellt. Eine planbare, verlässliche Verteilung der Arbeitsbelastung in den Veranstaltungen eines Moduls ist ein zentraler Faktor für das erfolgreiche Studium des Moduls. Liegt hier ein Missverhältnis vor, kann eine Veränderung des Workloads die Studiererfahrung eines Moduls und der parallel studierten Module verbessern. |
| Zeitaufwand im Modul erhöhen | Der Zeitaufwand in einem Modul setzt sich aus den Arbeitsstunden zusammen, die Studierende für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs (Präsenz- und Selbststudium) sowie der Studien- und Prüfungsleistungen aufbringen sollen. Dieser erwartete Aufwand soll dabei ausreichen, die Qualifikationsziele des Moduls zu erreichen. Ist der tatsächliche Zeitaufwand geringer als die angesetzten ECTS-Punkte, kann eine Erhöhung des angesetzten Zeitaufwandes Studierbarkeit eines Moduls verbessern. |
| Zeitaufwand im Modul verringern | Der Zeitaufwand in einem Modul setzt sich aus den Arbeitsstunden zusammen, die Studierende für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs (Präsenz- und Selbststudium) sowie der Studien- und Prüfungsleistungen aufbringen sollen. Dieser erwartete Aufwand soll dabei ausreichen, die Qualifikationsziele des Moduls zu erreichen. Ist der tatsächliche Zeitaufwand größer als die angesetzten ECTS-Punkte, kann eine Verringerung des angesetzten Zeitaufwandes Studierbarkeit eines Moduls verbessern. |